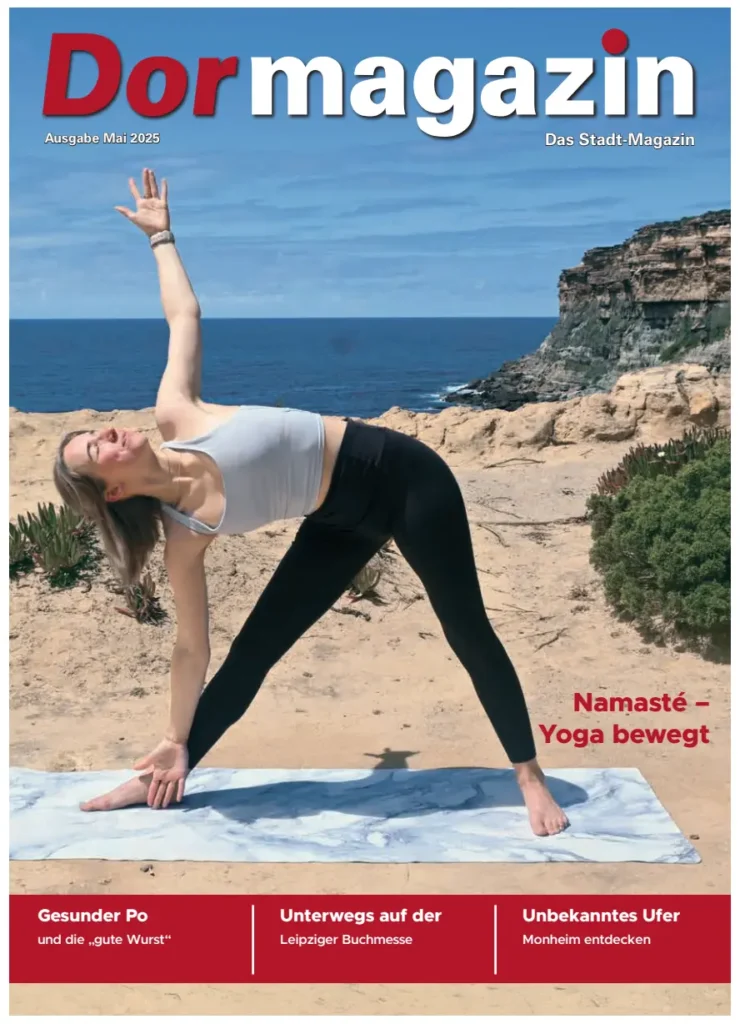Ob die Einwände etwas nützen? Schon jetzt sieht der Parkplatz wie eine Baustelle aus. (Foto: Andrea Lemke)
„Die ohnehin schon knappen Parkplätze in Zons sollen weiter reduziert werden. Die Stadt plant, mehr als die Hälfte der öffentlichen Parkplätze am Herrenweg in Zons „umzunutzen“ und an einen Bauträger zu verkaufen, um darauf Wohnhäuser zu errichten“, schreibt der Heimat- und Verkehrsverein Zons (HVV) in einer Pressemitteilung, die die Redaktion erreichte. Wegen angeblich mangelnder durchschnittlicher Auslastung der rund 100 Stellplätze werden mit dieser Planung rund 60 Plätze dauerhaft entfallen. Im Rahmen der aktuellen Öffentlichkeitsbeteiligung spricht sich der Vorstand des HVV entschieden gegen diese Planungen aus, weil damit 60 dringend benötigte Parkplätze ersatzlos wegfallen sollen. „Als einer der Hauptveranstalter wissen wir, dass Durchschnittszahlen keinerlei Bedeutung haben“, so der HVV. Für Zons zähle nur die Spitzenbelastung an den vielen Veranstaltungstagen und sonnigen Wochenenden, an denen jeder Parkplatz dringend benötigt werde. „Unser diesjähriger Matthäusmarkt stand wegen fehlender Parkplätze durch die nicht abgestimmte Sperrung der Tiefgarage und der Archiv-Dauerbaustelle kurz vor dem Aus und konnte nur durchgeführt werden, weil unsere Marktteilnehmer auf dem Dormagener Schützenplatz parken mussten“, erklärte der HVV. Bei einem ersatzlosen Wegfall der Stellplätze würde sich die touristische Infrastruktur in der Zollfeste deutlich verschlechtern und der Ärger vieler Anwohner und Besucher weiter zunehmen. Nach Meinung des HVV sollten sich Politik und Verwaltung dafür einsetzen, die Parksituation zu verbessern anstelle sie weiter zu verschlechtern. Mit seiner Einwendung gegen die Vorentwürfe appelliert der Vorstand deshalb an die Politik, „in diesem Fall auf zusätzliche Einnahmen für die Umnutzung der heutigen Parkflächen zu verzichten, um die örtliche und touristische Infrastruktur der alten Zollfeste für Bewohner und Besucher lebens- und liebenswert zu erhalten. (-sf/ale)